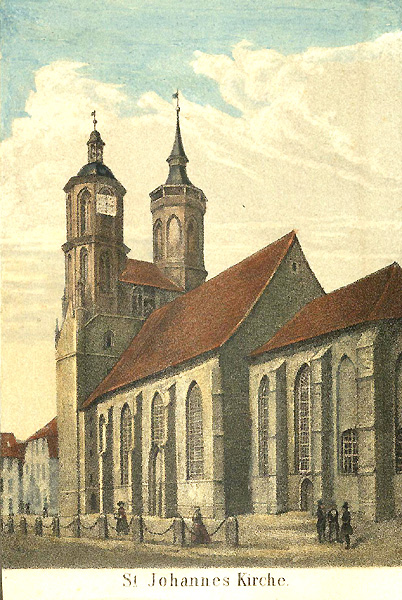| |

Zurück zum Stadtplan

|
St. Johannis
 Der Nordturm der gotischen Johanniskirche, in der der städtische
Türmer seine Wohnung hatte, bildete den höchsten Punkt der Telegraphenstrecke.
Der Nordturm der gotischen Johanniskirche, in der der städtische
Türmer seine Wohnung hatte, bildete den höchsten Punkt der Telegraphenstrecke.
Gauß
schrieb in diesem Zusammenhang am 13. Juni 1833 an Alexander von Humboldt:
„...Unser Weber hat das Verdienst, diese Drähte
gezogen zu haben (über den Johannisthurm und Accouchirhaus) ganz
allein. Er hat dabei unbeschreibliche Geduld bewiesen. Fast unzählige
Male sind die Drähte, wenn sie schon ganz oder zum Theil fertig waren,
wieder zerrissen (durch Muthwillen oder Zufall)... “
1845 berichtet
Gauß dem Astronomen Heinrich Christian Schumacher von dem spektakulären
Ende der Telegraphenleitung, bei dem beinahe der Nordturm der Johanniskirche
in Brand geraten wäre:
„Der auf den Johannisturm aufgefallene sehr starke Blitzschlag
hat sich wahrscheinlich ganz auf diese Drähte verteilt, sie alle
zerstört, in teils größere, teils kleinere Stücke
zerlegt, Stücke von vier bis fünf Zoll Länge und zahllose
Kügelchen wie Mohnkörner, die alle einen prachtvollen Feuerregen
gebildet haben.
[...] Schaden ist gar nicht geschehen, außer dass einer Dame von
herabfallenden glühenden Drahtstücken ein paar Löcher durch
den Hut gebrannt sind, aber sehr wahrscheinlich haben die Drähte
den Turm geschützt, der gar keine Ableitung darbietet, und, entzündet,
bei dem heftigen Sturm vielleicht Bibliothek und Stadt in große
Gefahr gebracht haben würde.“
Zur
Johanniskirche
Die Johanniskirche ist die größte der Göttinger Kirchen; bis zur Brandkatastrophe
im Januar 2005 prägte sie mit ihrer Doppelturmfassade die Silhouette der
Stadt.
Von einem romanischen Vorgängerbau hat sich ein Portal an der Nordseite
erhalten, das aus der Zeit um 1235 stammt.
Zu Beginn des 14. Jahrhunderts wurde ein gotischer Neubau begonnen, der
rund 50 Jahre später vollendet war. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde
die Johanniskirche in ihrem Inneren grundlegend umgestaltet. In den Jahren
1791/92 wurde nach Plänen von Georg Heinrich Borheck die Höhe des Chores
um etwa 3 m reduziert; im Chor wurde das gotische Gewölbe beseitigt.
An Stelle des Altars aus dem 17. Jahrhundert errichtete Borheck einen
Kanzelaltar.
Der Kanzelaltar
der Johanniskirche auf einem historischen Foto:

Die
Johanniskirche auf einer historischen Postkarte:
 zurück
zurück
|
|