| |

Zurück zum Stadtplan

|
Das Physikalische
Kabinett im Akademischen Museum
 Im Flügel des ehemaligen Paulinerklosters am Papendiek war neben
dem Akademischen Museum auch das Physikalische Institut untergebracht,
die Arbeitsstätte von Wilhelm Weber.
Im Flügel des ehemaligen Paulinerklosters am Papendiek war neben
dem Akademischen Museum auch das Physikalische Institut untergebracht,
die Arbeitsstätte von Wilhelm Weber.
Um für seine Leitungsführung günstige Räumlichkeiten
im Akademischen Museum zu erhalten, stellte Weber beim Hannoverschen Universitätskuratorium
im Februar 1832 den Antrag auf ein Zimmer im mittleren Stockwerk. Das
Kuratorium bat die anderen für das Gebäude zuständigen
Professoren, den Obermedizinalrat Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840),
Hofrat Johann Friedrich Ludwig Hausmann (1782– 1859) und Hofrat
Johann Friedrich Osiander (1787–1855), daraufhin um ihre Stellungnahme.
Diese zeigten sich Webers Wunsch gegenüber offenbar wenig aufgeschlossen
und überließen es ihrem Assistenten Ernst Friedrich Herbst
(1803–1893), einen Kompromiss vorzuschlagen. Daraufhin eröffnete
das Kuratorium Weber:
„daß zur Anstellung der optischen Versuche ihm zwar ein Zimmer
im academischen Museo nicht überwiesen werden kann, da keins von
den in diesem Gebäude befindlichen Zimmern für jetzt zu entbehren
ist. Dagegen kann ein, im mittleren Stockwerk des Musei befindlicher Vorplatz,
welcher ziemlich geräumig, sehr hell und bedielt sein soll, [...]
von dem Professor Weber zur Anstellung optischer Versuche inskünftige
benutzt werden und überlassen Wir daher demselben, hiervon den Umständen
nach Gebrauch zu machen.“
Weber wurde also kein Raum zugewiesen, sondern er musste seine Geräte
auf dem Flur installieren. In der Korrespondenz wird irrtümlicherweise
einige Male „optisch“ statt „elektrisch“ gebraucht,
was zeigt, dass Kenntnisse über Elektrizität auch in universitären
Kreisen noch nicht allgemein verbreitet waren.
Sowohl bei Weber im Physikalischen Kabinett als auch bei Gauß in
der Sternwarte waren je eine Sende- und eine Empfangseinheit aufgestellt
und mittels der Telegraphenleitung verbunden.
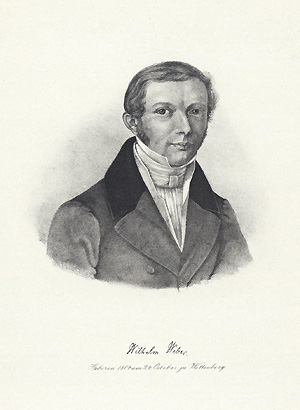 |
 |
Die
Ecke Papendiek/Prinzenstraße um 1910, bereits mit dem Gebäude
der Bibliothek:
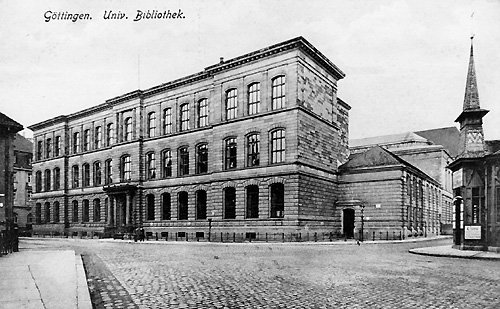
 zurück
zurück
|
|