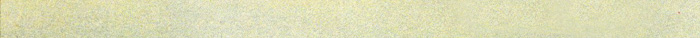|
|
|
Das Gauß-Weber Denkmal in Göttingen
|
|
|
Das Gauß-Weber Denkmal in Göttingen
Im Jahr 1891, unmittelbar nach dem Tod Wilhelms Webers, bemühte sich die Stadt um eine Würdigung des Physikers. Mit der Unterstützung zahlreicher prominenter Naturwissenschaftler konnte ein Doppeldenkmal für die beiden vielleicht bedeutendsten Gelehrten im Göttingen des 19. Jahrhunderts geschaffen werden. 1899 erfolgte die feierliche Einweihung des in eine repräsentative Anlage von Blumenrabatten eingebetteten Denkmals als Gauß-Weber-Anlage.
Geschichte des Denkmals:
Als am 100. Geburtstage von Carl Friedrich Gauß, dem 30. April 1877, in Braunschweig die Grundsteinlegung des Gaußdenkmals erfolgte, gab es in Göttingen, der Wirkungsstätte von Gauß, noch nichts Vergleichbares.
Anlässlich des Todes von Wilhelm Weber am 23. Juni 1891 gab es erste Überlegungen ihn durch eine "Wilhelm-Weber-Statue" zu ehren. Der Oberbürgermeister Merkel vertrat jedoch die Meinung, nicht nur Weber, sondern ihn und Gauß durch ein gemeinsames Denkmal zu ehren. Im Mai 1892 erschien zur Unterstützung dieses Vorhabens ein gedruckter Aufruf, den sieben Professoren der Universität Göttingen unterzeichnet hatten. An erster Stelle stand Felix Klein. Die Resonanz war geradezu überwältigend. Aus allen Teilen der Welt strömte das Geld zusammen. Es wurde ein Gauß-Weber-Denkmal-Comité gegründet, dem 17 Göttinger Prominente (12 Vertreter der Universität und fünf Vertreter der Stadt) angehörten.
Mit der Ausführung des Denkmals wurde der Berliner Bildhauer Prof. Ferdinand Hartzer (1838-1906) beauftragt. Hartzer war in Göttingen längst bekannt durch sein Wöhlerstandbild, das Portraitrelief auf dem Merkelstein und mehrere Bildnisbüsten (z.B. Albrecht von Haller und Rudolf von Jehring).
Dass es in diesem Fall ein Doppelstandbild werden sollte, stand für Hartzer von Anfang an außer Frage. Es wurden Betrachtungen über die Gruppierung beider Figuren angestellt, und Hartzer fertigte zwei Entwurfsmodelle an. Das Gußmodell war Anfang 1898 fertig gestellt und wurde im gleichen Jahr auf der "Großen Berliner Kunstausstellung" gezeigt. Alle drei, das Gussmodell und die beiden Entwurfsmodelle sind leider verschollen, zum Glück aber in alter Fotografie reproduziert.
Für das Denkmal selbst wurde ein Standort hinter dem alten chemischen Institut (Hospitalstr. 10) in den Wallanlagen gewählt. (Der Wall wurde hier Ende des 19. Jahrhunderts abgetragen). Von Kaiser Wilhelm II wurde die letzte finanzielle Lücke geschlossen, und am Sonnabend, den 17. Juni 1899, konnte das Denkmal eingeweiht werden.Das Standbild zeigt die beiden Gelehrten - Gauß sitzend und Weber stehend - in angeregter Unterhaltung. Sie sprechen über den elektromagnetischen Telegraphen, dessen Erfindung ihnen 1833 gelungen war. Zwei Dinge veranschaulichen dies. Es ist zum einen der Draht, den Gauß in seiner rechten Hand hält (leider nicht erhalten) und dessen Spule, die zwischen ihren Füßen liegt. Zum anderen stützt sich Weber mit seiner linken Hand auf den telegraphischen Zeichengeber.
Das Doppelstandbild zeigt die beiden Gelehrten etwa gleichaltrig. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, besteht doch zwischen beiden ein Altersunterschied von 27 Jahren. Weber war bei der Erfindung des elektromagnetischen Telegraphen erst 29 Jahre alt. Zunächst wollte Hartzer korrekt verfahren, ihm schienen aber, wie aus einem Brief an den Zoologen Ernst Ehlers hervorgeht, die Portraits aus Webers jüngeren Jahren nicht brauchbar zu sein. Es fehlten ihm die charakteristischen Züge von Weber. So argumentierte er, dass "in vielleicht 20 Jahren niemand an die Differenz des Alters denkt, sondern sie beide nur als die gemeinsamen Erfinder des Telgraphen betrachtet". Geheimrat Voigt sagte in seiner Weiherede: "Man war übereingekommen, den Altersunterschied zwischen Gauß und Weber nur ganz leise anzudeuten, im übrigen beide Männer in der Zeit ihrer vollsten Kraft darzustellen." Für Gauß hat Hartzer die Büste von Heinrich Hesemann (zwei Ausführungen 1855) und die Medaille von Friedrich Bremer (1855) herangezogen. Vermutlich hat Hartzer aber noch auf zwei weitere Darstellungen Bezug genommen. Zum einen das gemalte Portrait von Christian Albrecht Jensen (1840), das Gauß in seinem Kostüm zeigt; und die Lithographie von Eduard Ritmüller, auf der Gauß' ganze Gestalt auf der Terrasse der Göttinger Sternwarte zu sehen ist.
Weiter konnte er auch auf das schon erwähnte Braunschweiger Standbild von seinem Berliner Kollegen Fritz Schaper (Enthüllung 1880) zurückgreifen. Für Weber verfügte Hartzer als Vorlage für seine Gestaltung über die Totenmaske Webers und über verschiedene Photographien, die Weber im höheren Alter zeigten.Zahlreiche historische Postkarten zierte das Motiv des Gauß-Weber-Denkmals:
Ansichtskarte, 9 x 14 cm, Privatbesitz Wulf Pförtner, Göttingen
Postkarte anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der elektromagnetischen Telegraphie.
Abgebildet ist das Gauß-Weber-Denkmal in Göttingen, Zeichengeber und Empfänger.
In der Mitte ein Zitat aus dem Brief von Gauß an Olbers vom 20. November 1833.
Zurück