James
Franck

 |
Professor Hofsäß vom II. Physikalischen Institut der Universität Göttingen führt den Franck-Hertz-Versuch vor: Nachbau des Franck-Hertz-Versuchs, mit dem Franck und Hertz 1913 gemeinsam Stoßversuche zwischen Elektronen und Quecksilber-Atomen durchführten. Dabei machten sie die für die Entwicklung der Quantentheorie bedeutsame Entdeckung, dass die Atome mit der gleichen Energie quantenhaft angeregt und durch UV-Strahlung abgeregt werden. |
Im Jahre 1913 postulierte Niels Bohr, dass Atome nur konkrete Energieniveaus einnehmen können, d.h. ein Atom kann erst ab einer bestimmten Energie angeregt werden. Diese Energie kann durch einen Stoß zwischen einem Elektron und einem Atom zugeführt werden.
Den
Physikern Franck und Hertz gelang es 1913 mit diesem Versuch, die Energiezustände
der Atomhülle experimentell zu untersuchen. Beim Franck-Hertz-Versuch
dienen Quecksilberatome als Stoßpartner des Elektrons. Trifft das Elektron
auf das schwerere Hg-Atom, so gibt es einen Teil seiner Energie ab und fliegt
langsamer weiter.
Der Franck-Hertz-Versuch dient zum Nachweis der diskreten Elektronenorbitale
in Atomen. Wie von Bohr als Postulat aufgestellt, können Elektronen nur
»gequantelte« Energien aus einem Stoß aufnehmen. Beim Zurückfallen
in den energetisch niedrigeren Zustand werden Photonen entsprechender Wellenlänge
ausgesandt.
Das
Experiment zeigte, dass nur bei bestimmten Energiewerten eine Anregung der
Atomhülle gelingt, also eine Aufnahme der zugeführten Energie geschieht.
Wenn die Energie der Elek-tronen geringer als die niedrigste Anregungsenergie
der Atome ist, sind nur elastische Stöße möglich. Die innere
Energie der Atome wird dann nicht geändert, auch die Elektronen behalten
ihre kinetische Energie fast vollständig. Bei ausreichender Energie der
Elektronen sind unelastische Stöße möglich; d.h. die Elektronen
verlieren einen Teil ihrer kinetischen Energie an die Atome. Dieser Energiebetrag
entspricht genau der Anregungsenergie von 4,9 eV des Hg-Atoms.
Wichtigstes Resultat des Franck-Hertz-Versuchs ist zum einen, dass dieser
Schwellenwert existiert, und zum anderen, dass er genau gleich dem Planckschen
Energiequantum für die Resonanzlinie des Quecksilberdampfes ist. Dies
war eine wichtige Bestätigung der Grundannahmen der neuen Bohrschen Theorie
des Atoms.
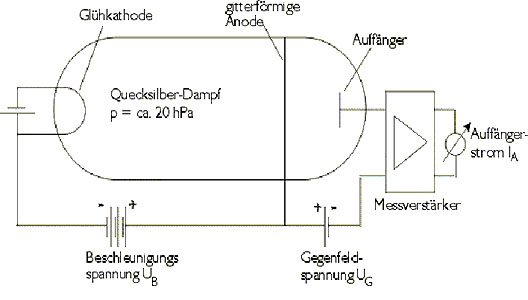 Skizze des Franck-Hertz-Rohres
Skizze des Franck-Hertz-Rohres
Eine Franck-Hertz-Röhre enthält eine kleine Menge Quecksilber, das bei Betriebstemperatur verdampft vorliegt. In der Röhre befindet sich neben Kathode und Anode ein Gitter, das stark positiv gegenüber der Kathode geladen ist, um die dort emittierten Elektronen in Richtung der Anode zu beschleunigen, wobei sie das Gitter durchfliegen. Gegenüber der Anode ist das Gitter schwach positiv geladen um Elektronen anzuziehen, die nicht durch die Beschleunigungsspannung frei geworden sind, also ungerichtet fliegen, bzw. ihre Energie durch einen (inelastischen) Stoß abgegeben haben. Auf diese Weise werden nur Elektronen einer von der Gegenspannung abhängigen Minimalenergie als Anodenstrom registriert. Dies ermöglicht erst, den für den Franck-Hertz-Versuch charakteristischen Kurvenverlauf zu messen.