| Home |
Effekte der ökologischen Schulkultur auf Schüler und Schülerinnen
Deutsche Zusammenfassung der Dissertation:
"Effects of Ecological Culture at School on Students" -
An empirical study and its implications for education
vorgelegt von
Rachael Dempsey
| Home |
Inhalt
Zu Kapitel 1 "Einführung und Geschichte" (to the english version)
Zu Kapitel 2 "Überblick über das allgemeinbildende Schulsystem in Deutschland und die Einführung der Umwelterziehung" (to the english version)
Zu Kapitel 3 "Theoretische Grundlagen der Arbeit" (to the english version)
Zu Kapitel 4 "Forschungsgrundlagen der Arbeit" (to the english version)
Zu Kapitel 5 "Folgestudie und Nacherhebung an 12 Schulen der Gesamtstichprobe" (to the english version)
Zu Kapitel 6 "Diskussion" (to the english version)
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (IPN) nahm ich an der "Studie zur Wirkung schulischer Umwelterziehung" (Rode et al, 2000) teil. Unter anderem war es meine Aufgabe, für die Ökologie relevante Schulmerkmale zu erforschen und als unabhängige Variablen auszuarbeiten. Diese Komponente der damaligen Studie nennt sich "das ökologische Profil" der Schule.
Die Forschungsergebnisse, die in Kapitel 4 erläutert sind, deuten auf einen weiteren Forschungsbedarf hin. Es konnten keine Schulen identifiziert werden, die sich hinreichend in ihrem "ökologischem Profil" unterschieden. Dieses Ergebnis bedeutete, daß das "ökologische Profil" einer Schule so, wie es erhoben wurde, untauglich war, die beobachteten Unterschiede hinsichtlich umweltrelevanten Verhaltens bei Schülern zu erklären.
Daher wurde eine Folgeuntersuchung von mir geplant und durchgeführt. Zum einen sollten Schultypen anhand der ökologischen Merkmale der Schulen identifiziert und charakterisiert werden. Zum anderen sollten die gewonnenen Erkenntnisse über die Schulen einen Beitrag liefern, die bei den Schülern beobachtete Varianz der Umweltmotivation, der Umweltaktivität an der Schule und des Wissens über Natur- und Umweltschutz an der Schule zu erklären. Die hier untersuchten und im folgenden beschriebenen ökologischen Merkmale der Schule werden als "ökologische Kultur" bezeichnet.
Diese Arbeit ist ein erster Versuch, die ökologische Schulkultur systematisch zu erfassen und ihrer Wirkung auf Schüler und Schülerinnen auf die Spur zu kommen. Die ökologische Schulkultur ist das Thema meiner Dissertation, die im Folgenden auf Deutsch zusammengefaßt ist.
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 1 "Einführung und Geschichte"
In Deutschland ist die Auseinandersetzung mit dem Thema der kindes- und jugendgerechten Gestaltung der Schule und des Lernprozesses recht alt. Zum Beispiel Comenius (1592 - 1670) und August Hermann Franke (1695) plädierten dafür, daß die Schulen auch die Natur einbeziehen, z.B. in Form eines Schulgartens, der die ästhetischen sowie erkundenden Bedürfnisse der Schüler befriedigen soll.
In der Folge des zweiten Weltkrieges mußten insbesondere Schulen der Großstädte erhebliche Rückschritte hinnehmen, was die Schulgeländegestaltung betraf. Extreme Zerstörung und eine Verschiebung der Prioritäten hatten als Resultat, daß in dieser Zeit (und auch später noch) das Schulgelände eher vernachlässigt wurde. Das Thema wurde Ende der fünfziger Jahre wieder aufgegriffen. Es wurde erwogen, Richtlinien für die Gestaltung von Räumlichkeiten und Schulgeländen zu formulieren.
Eine öffentliche Stellungnahme zur ökologischen Geländegestaltung ist z.B. in Niedersachsen erst 1991 in Form eines vom Kultusministerium herausgegebenen Leitfadens "Ökologische Umgestaltung des Schulgeländes" (Bastian, 1991) entstanden. Dieser Leitfaden definiert die Funktionen und allgemeinen Ziele, die mit der Gestaltung des Schulgeländes angestrebt werden. Die Ziele beinhalten auch, der Ökologie zu dienen. Aber es wird betont, daß die Gestaltung des Schulgeländes in erster Linie die Identitätsentwicklung der Schüler zu fördern hat.
Den dort genannten Funktionen, Zielen und Lernzielen liegt bereits die Annahme zugrunde, daß zur Identitätsentwicklung von Schülern auch die Aneignung von Umweltverhalten gehört und eine angemessene Geländegestaltung hierzu beitragen kann.
1993 wurde "Kinderfreundlichkeit" (die Belange der Kinder) das zentrale Thema der Jahrestagung der Kinderbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Ergebnisse sind in Form eines Entwurfs eines "Prüfverfahrens Kinderfreundlichkeit" für mehrere Lebensbereiche von Kindern dokumentiert worden (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 1993). Dieses Arbeitsbuch identifiziert Schule als einen Ort, an dem immer mehr Kinder einen Großteil ihrer sozial-emotionalen und vor allem sinnlich- motorischen Erfahrungen sammeln.
Durch die Verkehrsentwicklung, die funktionale Entmischung der Flächennutzung und Verdichtung der bebauten Gebiete ist es zu einer Einengung der Räume gekommen, in denen Kinder sich aufhalten können. Zusätzlich führt die Einengung zu einer Verlagerung des Aufenthalts der Kinder von draußen nach drinnen. Nach Knauf (1993) sind Lernziele nach wie vor die primäre Aufgabe der Schule. Die veränderten Lebensbedingungen vieler Schüler implizieren eine Erweiterung der Aufgaben der Schule, die nunmehr einen "Prozeß der Umweltauseinandersetzung" in Gang setzen soll und dabei die Gestaltung der "Lernumgebung" oder "schulischer Lernumwelten" realisieren soll. In dem oben genannten Arbeitsbuch sind die ausgearbeiteten Leitfragen und Prüfkriterien des Lebensbereichs Schule präsentiert.
Seit 1996 gibt es in Schleswig-Holstein - bisher einmalig in der Bundesrepublik - eine eigenständige kommunalverfassungsrechtliche Regelung über die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der gemeindlichen Entscheidungsfindung. Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen berühren, diese beteiligen. Hartmut von Hentig verweist auf die Bedeutung der Schule: "Man muß die Schule - die einzige Einrichtung, die der Gesellschaft dafür zur Verfügung steht - zur polis machen, da man im kleinen die Versprechungen und Schwierigkeiten der großen res publica erfährt und die wichtigsten Tätigkeiten übt: Ein Problem oder Interesse definieren und es öffentlich verhandeln, andere Menschen überzeugen und sich von ihnen überzeugen lassen, Entscheidungen treffen und austragen, Konflikte nicht scheuen, aber auch beenden können, Vereinbarungen treffen, Zuständigkeiten bestimmen und dergleichen mehr" (Tiemann, 1997).
Weiterhin fördert das Land Schleswig-Holstein zusammen mit dem Deutschen Kinderhilfswerk (Berlin) im Rahmen der Aktion "Schleswig-Hoslstein - Land für Kinder" verschiedene Beteiligungsprojekte von Kindern und Jugendlichen. Projekte mit der Zielorientierung, die Qualität des Schulhofes zu erhöhen, sind hier auch vertreten. Die Strategien dieser und gleichartiger Projekte sind in Form von zur Zeit drei Handbüchern dokumentiert worden (Siehe z.B. Brunsemann, 1997).
Fazit: die Gestaltung des Schulgeländes sowie Schülerpartizipation (Mitbestimmung und Mitverantwortung) werden mittlerweile als Instrumente des Lernens und der Aneignung umweltrelevanten Verhaltens anerkannt.
Wie kann oder wird das Lernziel "umweltrelevantes Verhalten" aber nun tatsächlich im Schulalltag umgesetzt?
Diese Diskussion führt uns zum Thema "Umwelterziehung" und "Umweltbildung".
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 2 "Überblick über das allgemeinbildende Schulsystem in Deutschland und die Einführung der Umwelterziehung"
Es gab vier bedeutsame Ereignisse für die Einführung der Umwelterziehung im allgemeinbildenden Schulsystem Deutschlands:
Die KMK 1980 spielte auch eine wichtige Rolle bei der Einführung von Umwelterziehung in Curricula und Schulbüchern. Das IPN trug mit der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und empirischen Studien zur Implementation von Umwelterziehung bei.
Allerdings spielt die Geländegestaltung von Schulen in der praktischen Umsetzung von Umwelterziehung kaum eine Rolle. "Umwelt" wird fast ausschließlich als theoretisches "Unterrichtsthema" - wie ein Schulfach - behandelt und oft als eine Unterrichtsmethode unter vielen aufgefaßt. Zudem stehen sie oftmals in einer regelrechten Konkurrenz zu vielen anderen Unterrichtsinhalten und -methoden (Rode et al, 2000).
Das Erlernen oder gar die Veränderung von umweltrelevanten Handlungsweisen - kann, darauf weisen Vertreter aus Bildung und Psychologie hin, weder durch eine punktuelle Behandlung (als Unterrichtsthema) erreicht werden, noch die Aufgabe von Unterricht alleine sein. Kapitel 3 faßt deshalb Erkenntnisse der Handlungstheorie zusammen, die besagen, daß die Schule auch durch ihre physische Gestaltung und ihre Praktiken dem gegenwärtigen und zu erwerbenden Verhalten von Schülern Rechnung tragen muß.
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 3 "Theoretische Grundlagen der Arbeit"
Vygotsky (1987) schrieb vor fast siebzig Jahren, daß Gegenstände, Erfahrungen und Verhaltensweisen Konstrukte der Kultur sind. Das Verhalten von Menschen kann dann nur im Kontext ihrer eigenen Kultur verstanden werden. Bildung, Entwicklung und Sozialisation beinhalten das Lernen, wie man sich in dieser Kultur richtig verhält. Dieses richtige Verhalten und die Kultur sind unzertrennlich und ein soziales Geschehen.
Nach Vygotzky wäre Umweltverhalten (und damit das erwünschte Ziel von Umwelterziehung) nur das, was sich auch im Kontext einer gegebenen Kultur als das Richtige erkennen läßt.
Nach Bronfenbrenner (1978) ist "Schule" als ein solcher Kulturraum zu sehen. Für Bronfenbrenner ist Schule nicht eine große Schachtel in welcher man wiederum kleinere Schachteln findet, in denen hauptsächlich und isoliert voneinander Lehren und Lernen stattfindet. (Von der Nutzung von Räumlichkeiten außerhalb des Klassenzimmers oder von außerschulischen Standorten zur Unterstützung des Unterrichts ist hier gar nicht die Rede.) Sondern Bronfenbrenner sieht die Schule an sich als "Umwelt" oder vielmehr als kulturelles Ereignis, das einen bedeutenden Einfluß auf Schüler hat.
Kultur wird hier als ein wechselseitiger Prozeß der Prägung beschrieben, innerhalb dessen sowohl die Menschen ihre Umwelt und die dazugehörigen physischen Gegenstände mitgestalten, als auch die Umwelt den Menschen. Eine Wechselwirkung findet zwischen dem Gegenstand "Schule" und dem Verhalten der Personen statt.
Das heißt, die Verhaltensweisen und die Gegenstände der jeweiligen Schulkultur erziehen ihre Schüler. (In Anbetracht der Einschränkung dieser Studie auf das umweltrelevante Handeln wurde der sehr umfassende Begriff "Kultur" der Schule als "ökologische Kultur" spezifiziert.) Allerdings muß eine ökologische Schulkultur nicht ökologisch sein, um das Verhalten der Schüler zu beeinflussen. Eine Schule, ob es beabsichtigt ist oder nicht, beeinflußt das Umwelthandeln der Schüler über die alltägliche Schulpraxis. So ist z.B. die Erfahrung über den Umgang mit Papier entscheidend, indem sie bei Schülern zur Erkenntnis dessen beiträgt, welche Handlungen (in dieser Kultur) möglich, akzeptiert und letzten Endes normal sind. Es sind die "normalen" Handlungen, wie die, die an der Schule tagtäglich vorgeführt werden, die als geeignete oder richtige Handlungen assimiliert werden (Cook, 1981; Weigel, 1976).
Der Erwerb "verantwortlichen Umweltverhaltens" beruht nach Fietkau (1984) auf fünf notwendigen Bedingungen:
Auch diese Bedingungen fordern die Schule auf, über den Unterricht hinaus zu denken, wenn umweltrelevantes Verhalten bei Schülern ein Lernziel der Schule ist, und in das pädagogische Konzept die ökologische Schulkultur (u.a. die Gestaltung und die Praktiken dort) einzubeziehen ist.
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 4"Forschungsgrundlagen der Arbeit"
Die bisherigen theoretischen Betrachtungen haben noch nicht die Rolle der ökologischen Schulkultur für die schulische Umweltbildung berücksichtigt. Ebenfalls ist die ökologische Schulkultur noch nicht in ein Modell zur Erklärung von umweltrelevantem Handeln integriert.
Im folgenden werden zusammengefaßt, 1) Forschungsergebnisse zu Wirkungen der Umweltbildung, 2) ein Modell zur Erklärung von umweltrelevantem Handeln, 3) ein statistisches Auswertungsverfahren (Mixed-Rasch-Modell und Latent-Class-Analyse) und 4) weitere relevante Forschungsergebnisse, die die Einbeziehung und Untersuchung der ökologischen Schulkultur als weiteren Faktor der schulischen Umwelterziehung unterstützen.
Forschungsergebnisse zu Wirkungen der Umweltbildung
Obwohl schulische Umwelterziehung seit 20 Jahren und in manchen Schulen sogar seit über 30 Jahren praktiziert wird, befindet sich die Forschung zur Umwelterziehung erst im Anfangsstadium. Insbesondere finden sich Studien über die Wirkung von Umwelterziehung nur selten (Leeming, 1993; Leeming, 1997). In der Dissertation sind wichtige Ereignisse der Wirkungsforschung im Bereich Umwelterziehung zusammengefaßt (Abschnitt 4.1 und auch zu Anfang von Kapitel 5). Hier seien nur drei Forschungsarbeiten hervorgehoben, welche einige Grundkonzepte einführen, auf die sich das Modell zur Erklärung umweltrelevanten Handelns stützt.
Diese Arbeit unterstützt die Untersuchungsthese, daß schulische Handlungsangebote in Sachen Umwelt ein Faktor des Umweltverhaltens bei Schülern sind und daß schulische Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts auch ihre Wirkungen bei Schülern zeitigen.
Diese Forschung gilt als Pionierarbeit zur Identifizierung von kognitiven Variablen, die das Verhalten in Sachen Umwelt beeinflussen und wurde zur Auswahl der Variablen des Modells zur Erklärung umweltrelevanten Handelns in der hier vorliegenden Forschungsarbeit herangezogen.
Diese Arbeit spricht nicht ausdrücklich von einer ökologischen Schulkultur sondern von hemmenden "gesellschaftlichen Sanktionen", was sozusagen auf der Kehrseite der Medaille steht, die auf der vorderen Seite den Stempel der Notwendigkeit verantwortlichen Umwelthandelns nach Fietkau (Siehe Kapitel 3) trägt. Das bedeutet, daß wir im Rahmen der Schule mit "gesellschaftlichen Sanktionen" (einer ökologischen Kultur) rechnen müssen, die Intentionen zum Handeln - gegen die Umwelt ebenso wie für die Umwelt - hemmen können.
Es konnten keine Studien über Umweltverhalten gefunden werden, die die "Schule" oder Schulkultur als Lernfaktor untersuchten. Allerdings deuten einige der in dieser Arbeit referierten Forschungsergebnisse darauf hin, daß die ökologische Schulkultur einen entscheidenden Einfluß auf die Ergebnisse von Umweltbildung hat und systematisch berücksichtigt werden muß.
Ein Modell zur Erklärung von umweltrelevantem Handeln
In Kapitel 4 geht es nicht nur um bisherige Forschungsergebnisse, die weiter verfolgt werden s einem Bedürfnis, eine wahrgenommene Umweltbedrohung ("threat") zu mindern, die durchaus als persönliche Betroffenheit empfunden werden kann, aber nicht ausschließlich und notwendig als solche empfunden werden muß. "Ich", aber auch andere Mitmenschen oder auch Tiere und Pflanzen könnten als betroffen gelten, deren Gefährdung "ich" mindern möchte. Die Empfindung von Bedrohung wird von dem Coping-Stil und der Verantwortungsattribution ("attribution of responsibility") begleitet. Fördern diese drei Kognitionen (Siehe die Motivationsphase in Abb. 1) ein Bedürfnis, die Bedrohung zu mindern, ist die Phase der Motivationsbildung abgeschlossen und die zweite Phase der Handlungsauswahl kann beginnen.
Die Handlungsauswahlphase ("action choice phase") ist durch die folgenden Kognitionen charakterisiert: Handlungsfolgeerwartung ("outcome expectation"), Kompetenzerwartung ("self-competence" oder auch Selbstwirksamkeit) und Instrumentalität. Fördern diese Kognitionen die Auswahl einer Handlung, kann die letzte Phase des tatsächlichen Umsetzens einer Handlung beginnen - die Volitionsphase.
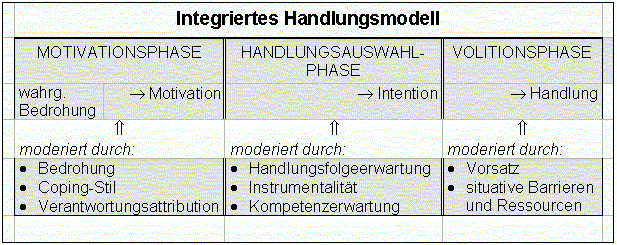
Abbildung 1: Das integrierte Handlungsmodell nach Rost et al (1995)
Das integrierte Handlungsmodell wurde in einem Modell zur Wirkung schulischer Umwelterziehung eingesetzt. Während des Schuljahrs 1996/97 wurde eine Umfrage bei 2365 Schülern und ihren Lehrern an 54 Schulen aus sieben Bundesländern durchgeführt (Rode et al, 2000). Diese Untersuchung stellte das integrierte Handlungsmodell als abhängigen Variablenblock dar. Als unabhängige Variablen wurden Variablen über Unterricht, über den schulischen Kontext und über Schülermerkmale definiert (Abb. 2). Ziel war es, die einzelnen Komponenten von Umwelterziehung an Schulen zu charakterisieren und damit umweltverhaltensrelevante Wirkungen bei Schülern zu erklären.
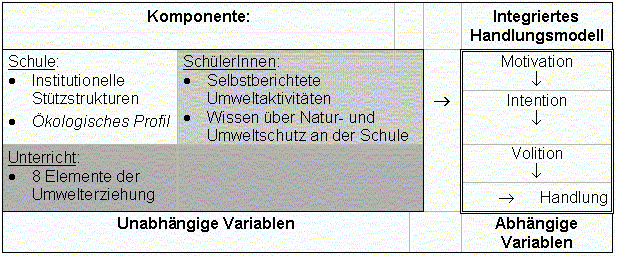
Abbildung 2: Modell zur Wirkung schulischer Umwelterziehung (Rode et al, 2000)
Nur ein kleiner Teil der Umfrage ist dem schulischen Kontext gewidmet. Mit der Erhebung der Komponente "Schule" wurde angestrebt, u.a. ein ökologisches Profil der Schulen zu erfassen. 26 Items zum Vorhandensein von Einrichtungen und Maßnahmen des Umweltschutzes an der Schule wurden geprüft. Dazu kamen Fragen über die Handlungsangebote für Schüler (die Fragebögen sind im Anhang enthalten). Aus den Antworten zu den mehrfachen Fragen entsteht ein ökologisches Profil der Schule. Idealerweise lassen sich Gruppen von Schulen bilden, die sich in ihrem ökologischen Profil ähnlich sind. Jede Schulgruppe wäre dann nach besonderen Ausprägungen der schulischen Merkmale sowie nach Merkmalen ihrer Schüler charakterisiert. Der Vergleich von verschiedenen Schulgruppen ermöglicht dann eine tiefere Einsicht in solche Merkmale, die zur Erklärung von Wirkungen bei Schülern beitragen können.
Im Anhang sind Erläuterungen zum Untersuchungsdesign und zu den Erhebungsinstrumenten enthalten.
Statistisches Auswertungsverfahren und relevante Ergebnisse
Die empirische Studie zur "Wirkung schulischer Umwelterziehung" (Rode et al, 2000) lieferte die, in dieser Untersuchung verwendeten Daten über die Schüler und hier insbesondere zu den abhängigen Variablen des Handlungsmodells. Es werden wesentliche Ergebnisse zusammengefaßt über:
Bevor ich mit der Beschreibung der Ergebnisse fortfahre, möchte ich auf eine Besonderheit dieser Arbeit eingehen, nämlich die Auswertungsverfahren.
Diese Studie hat das Ziel, Gruppen von Schülern zu identifizieren, die sich in ihren Profilen der Variablen des integrierten Handlungsmodells unterscheiden. Das Auswertungsverfahren (Abschnitt 4.4, Latent Class Analysis; Rost, 1996) teilt die heterogene Gesamtgruppe in statistisch homogene Untergruppen. Jede Untergruppe ist charakterisiert durch das besondere Antwortprofil der Schüler hinsichtlich der Modellvariablen. Dieses Auswertungsverfahren zeichnet sich dadurch aus, daß es Zusammenhänge zwischen mehreren Variablen berücksichtigt, indem es homogene Personengruppen bildet und damit ganze Schülerprofile und nicht nur Mittelwerte einzelner Variablen unterscheidet.
Anhand des Auswertungsverfahrens und der entstehenden Untergruppen können die folgenden Profile von Schülern zur Umweltmotivation (Umwelttypen) nach dem integrierten Handlungsmodell unterschieden werden.
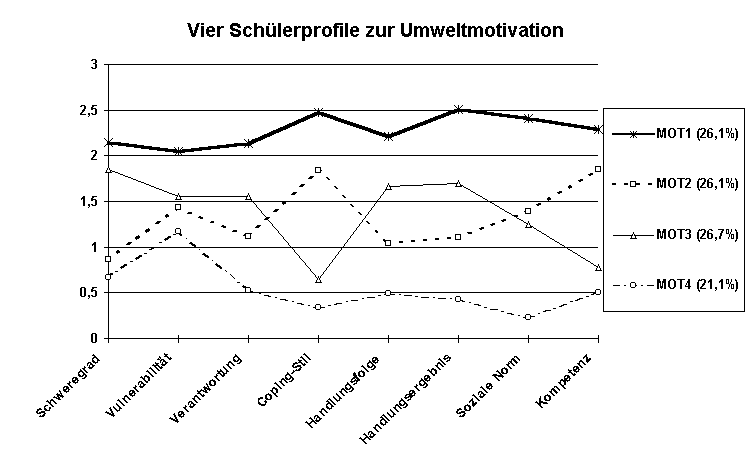
Abbildung 3: Vier Motivationstypen von Schülern
Abbildung 3 stellt die Untergruppen von Schülern dar, die mit Hilfe des Auswertungsverfahrens Latent Class Analyse entstanden sind. Die Linien zeigen die charakteristischen Antwortprofile der Untergruppen. Auf der X-Achse befinden sich die Variablen des integrierten Handlungsmodells, die untersucht wurden. Auf der Y-Achse sind die Werte der vierstufigen Ratingskala dargestellt.
Zwei gleich große Gruppen, die sich in ihrem bevorzugten Coping-Stil und ihrer Kompetenzerwartung deutlich unterschieden, liegen dazwischen.
Gehen wir nun davon aus, daß, erstens, das integrierte Handlungsmodell eine Kette von Motivationskognitionen darstellt, die "erreicht" werden müssen, um entsprechendes Umwelthandeln zu fördern, daß, zweitens, die Latent Class Analyse tatsächlich valide Profile von Schülermotivation abbildet, umweltverantwortlich zu handeln, und daß, drittens, Motivation und tatsächliches Umwelthandeln positiv korrelieren, dann sind solche Profile bedeutsam für die pädagogische Analyse und Intervention.
Die Analyse ist nützlich, wenn festgestellt wird, daß für mehrere Schüler ein und dasselbe Glied in der Kette "gebrochen" ist und Motivation dadurch verhindert wird. Zum Beispiel: Es wurde festgestellt, daß Schüler der Gruppe MOT1 nicht nur ein stärker ausgeprägtes Motivationsprofil haben als Schüler der anderen Gruppen, sondern auch, daß sie über deutlich mehr Handlungen in Sachen Umwelt außerhalb der Schule berichten. Schüler der Gruppe MOT2 stehen hierbei an zweiter Stelle und Gruppe MOT3 an dritter Stelle für selbstberichtete außerschulische Umwelthandlungen. Gruppe MOT4 berichtet das geringste Engagement. Und dies deutet daraufhin (allerdings nicht bestätigt), daß Umwelthandeln und Motivation positiv korrelieren könnten.
Mit diesen vier Profilen kann man gut weiterarbeiten, um Zusammenhänge zwischen Motivation und den übrigen unabhängigen Variablen festzustellen, die für die Bildungspraxis relevant sind. So sehen wir, daß die wesentlichen Unterschiede zwischen z.B. den Profilen MOT1 und MOT3 im jeweiligen Coping-Stil und oder Kompetenzerwartung der Schüler liegen. Gerade hier wären nach dieser Analyse möglicherweise gute Anhaltspunkte für Nachforschungen, warum diese Schülergruppen sich unterscheiden, warum die eine Gruppe mehr Motivation zum Umwelthandeln zeigt als die andere und ob die "Ursachen" sich durch pädagogische Intervention beeinflussen lassen.
Während wir bis hierher das Auswertungsverfahren erläutert und beispielhaft dargestellt haben, wollen wir uns nun den Ergebnissen der Untersuchung zuwenden.
Zu den abhängigen Variablen (Motivation)
Zu den einzelnen unabhängigen Variablen (Aktivität, Wissen und ökologisches Profil)
Die Items, das Erhebungsverfahren und die Ergebnisse sind in der Dissertation ausführlich erläutert. Hier werden nur Ergebnisse zusammengefaßt.
Zu den Ergebnissen über die Zusammenhänge zwischen Motivation und den Variablen Aktivität und Wissen
Zum Zusammenhang zwischen Variablen der Schul- und der Schülerebene
Vor Ort ist es durchaus sichtbar, daß Schulen unterschiedlich ausgestattet sind und sie den Schülern Handlungsangebote unterschiedlicher Qualität anbieten. Auch unsere Ergebnisse deuten mehrfach darauf hin, daß es durchaus schulische Unterschiede gibt - insbesondere durch die deutlichen Unterschiede in der "sozialen" Zusammensetzung der Schülermotivationsgruppen an Schulen. Anhand der Daten der ursprünglichen Untersuchung konnten allerdings keine wesentlichen Unterschiede gemessen oder erklärt werden. (Die Differenzierung zwischen "mehr" oder "weniger" Umweltschutz an Schulen lieferte keine Einsicht in die beobachteten Unterschiede innerhalb der Schülerpopulation.)
Es müßte doch möglich sein, so dachte ich, Unterschiede zwischen Schulen zu erfassen, die weiterhelfen, die bei den Schülern beobachteten Unterschiede besser zu verstehen.
Eine Beschreibung des eigentlichen Untersuchungsobjekts und -designs
Die Formulierung meiner Forschungsfragestellung wurde von zwei Grundannahmen geleitet:
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 5 "Folgestudie und Nacherhebung an 12 Schulen der Gesamtstichprobe"
Kapitel 5 stellt im wesentlichen folgende Aspekte meiner Nachfolgeuntersuchung dar:
Der Untersuchungsrahmen war vorgegeben. Es standen mir je ein Interview und ein Besuch vor Ort für 12 Schulen der ursprünglichen Stichprobe zur Verfügung. Ein Untersuchungskonzept und die Erhebungsinstrumente mußten entwickelt werden.
Stichprobe
Auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse wurden Kriterien für die Auswahl der 12 Schulen für die Nachuntersuchung erarbeitet. Folgende Kriterien wurden berücksichtigt:
Die Instrumente
Obwohl Umweltpsychologen wie Itelson (1974) und Moos (1976) uns überzeugen wollen, daß die physische Welt und unsere persönliche innere Welt eng miteinander verbunden sind, daß die Umwelt sogar einen entscheidenden Einfluß ausübt und daß die Schulwelt eine verantwortungsträchtige Umwelt der Schüler bildet (insbesondere im Bezug auf menschliches Handeln), liefern sie keine objektivierbaren, beobachtbaren oder erhebbaren Details. Dies erschwerte die Entwicklung neuer Erhebungsinstrumente für die Nachuntersuchung (Beobachtungsbögen und strukturierter Interviewleitfaden).
In den letztendlich verwendeten Erhebungsinstrumenten ist der Block unabhängiger Variablen zur "ökologischen Kultur" einer Schule operationalisiert. Dabei sind zwei Dimensionen und vier Variablen zu unterscheiden:
Dimension 1: ökologische Gestaltung. Dieser Teil der Datennacherhebung umfaßt die physisch wahrnehmbare Ausstattung einer Schule. Beispiele für solche Merkmale (Variablenkomplex 1) können die naturnahe Gestaltung des Schulgeländes und die Bereitstellung von Möglichkeiten zum Naturerleben auf dem Schulgelände selbst sein.
Dimension 2: ökologische Praktiken. Dieser Teil versucht die systemischen Verhaltensaspekte einer Schule zu berücksichtigen. Die Verhaltensaspekte sind in drei Bereiche untergliedert.
Das Beobachtungsinstrument
Die nächste große Herausforderung war die Operationalisierung dieser Variablen. Durch Beobachtung wurden Daten zur Dimension 1 erhoben. Bis jetzt konnte noch kein quantitativer Maßstab entwickelt werden, um die Ökologisierung einer Schule messen zu können. Die Herausforderung lag darin, die bisher genannten und qualitativ umschriebenen Faktoren in quantitative Größen umzusetzen, um eine vergleichende Analyse von Schulen zu ermöglichen. Letzten Endes ist es das Ziel dieser Instrumente, ein Bewertungssystem zu entwickeln, um schulische "Landschaften" anhand physischer Merkmale zu beurteilen.
Die Entwicklung der Beobachtungsinstrumente erfolgte in vier Schritten:
Eine detaillierte Erläuterung dieses Arbeitsmodells und der daraus entstandenen Beobachtungsinstrumente ist in der Dissertation enthalten (Abschnitt 5.2.1). Hier sollen lediglich zu den obengenannten Punkten 2 und 3 die sechs Strukturmerkmale der ökologischen Schulgestaltung und deren Attribute, auch Leitelemente genannt (Abbildung 4), kurz dargestellt werden.
Merkmale und Attribute der ökologischen Schulgestaltung |
||
Merkmal |
Attribute |
|
Layout |
|
|
Design |
|
|
Flächen |
|
|
Zustand |
|
|
Naturerleben |
|
|
Natur- und Umweltschutz |
|
|
Abbildung 4: Merkmale und Attribute der ökologischen Schulgestaltung
Anhand der Ausprägungen der Attribute wurden die sechs Merkmale für die jeweilige Schule und deren Gelände bewertet. Die zu Punkt 4 ausgearbeiteten Antwortkategorien waren so konzipiert, daß sie eine dreistufige Skala der Variablenausprägung darstellten und damit einen Vergleich der Merkmale zwischen den Schulen ermöglichten. Im Anhang finden Sie den Bewertungsbogen (auf Deutsch) und die resultierenden skalierten Antwortkategorien (auf Englisch!), die die Ausprägung der Strukturmerkmale wiedergeben.
Das Interview
Das Ziel des Interviews war eindeutig begrenzt - es diente u.a. der Erhebung von Daten zu allgemeinen Praktiken, Schülerpartizipation und zur Haltung der Schulleitung. Die Aussagen der Schulleitungen allerdings sollten möglichst vergleichbar erhoben werden, was eindeutige Rückwirkungen auf die Methode hatte. Das Interview erfolgt deshalb einem Leitfaden, der streng eingehalten werden mußte, sowie einem begleitenden strukturierten Antwortformat (als Empfehlung an den Interviewten) (siehe Anhang).
Die Zentralfragen des Interviews sind:
Das Untersuchungsdesign
Wenig erklärt wurden bisher die Mechanismen, nach denen schulische Bedingungen (Kultur) Einfluß auf Schüler nehmen. Hier greife ich auf Arbeiten der allgemeinen Psychologie zurück (Bronfenbrenner, 1978; Vygotzki, 1987), die besagen, daß die "Kultur" - auch eine schulische Kultur - in ihren Manifestationen und in Verhaltensweisen einen Beitrag zum Bildungsprozeß liefern. So kann ich das Modell zur Wirkung von Umweltbildung an der Schule auf Schüler für meine Untersuchung anpassen und um eine Berücksichtigung der "ökologischen Kultur" als unabhängiger Variablenkonstellation erweitern. Vergleichen Sie den Inhalt des unabhängigen Variablenkomplexes der "ökologischen Schulkultur" (Abb. 5) mit dem der Schulkomponente "ökologisches Profil" (Abb. 2). Die Ansichten der Schüler über ihre eigenen Umweltaktivitäten sowie ihr schulökologisches Wissen sind als erworbenes Produkt oder Resultat der Schulkultur zu verstehen. Deshalb gehören diese beiden Variablen in diesem Modell nicht mehr zu den unabhängigen (wie in Abb. 2), sondern müssen den abhängigen Variablen zugerechnet werden.
Abbildung 5: Modell zur Wirkung ökologischer Schulkultur
Anhand dieses Modells habe ich eine neue Arbeitshypothese erarbeitet. Sie lautet:
Schulen, die ihr Gelände ökologisch gestalten, aktuelle (kulturell bedingte) Praktiken in Natur- und Umweltschutz widerspiegeln, Schülerpartizipation bei relevanten Entscheidungsprozessen an der Schule fördern und eine positive Haltung zu Natur- und Umweltschutz vor Ort an der Schule zeigen, zeigen eine positiv ausgeprägte ökologische Kultur. Dadurch fördern diese Schulen die Sensibilität sowie Fähigkeiten in Sachen Natur und Umwelt bei Schülern. Diese Schüler werden einen höheren Wissensgrad über Natur- und Umweltschutz an der Schule und ausgeprägtere Natur- und Umweltschutzaktivität an der Schule zeigen, die sich in einer höheren umweltrelevanten Motivation niederschlagen.
Anhand dieses Modells und der bisher gewonnenen Erkenntnisse über Schüler wurden vier Kategorien von ökologischen Schulkulturen und ihren antizipierten Wirkungen auf Schüler theoretisch formuliert (Siehe Abb. 6).
Abbildung 6: Antizipierte ökologische Schulkulturen und ihre Wirkungen auf Schüler
In Abbildung 6 werden die erwarteten Typen ökologischer Schulkulturen geschildert. Es wird prinzipiell davon ausgegangen, daß sich die einzelnen Schulen mit entweder niedrigen oder hohen Ausprägungen der Dimensionen bewerten lassen. Zudem wird postuliert, daß eine positive Ausprägung einer Dimension eine positive Wirkung auf Schüler hat und, daß z.B. eine positive Ausprägung im Bereich Gestaltung eine positive Auswirkung auf die Umweltmotivation von Schülern hat. Zudem wird vermutet, daß diese Wirkung bei Schülern verstärkt wird, wenn eine positive Ausprägung beider Dimensionen an einer Schule vorkommt. Daraus entstehen vier Typen von ökologischen Schulkulturen.
So wird, zum Beispiel, die ökologische Kultur an Schulen als "stark" gekennzeichnet, wenn sich hohe Ausprägungen für beide Dimensionen erkennen lassen. Als Folge einer ausgeprägten Umsetzung ökologischer Werte bei der Gestaltung und Praktiken an der Schule wird erwartet, daß sich Schüler an diesen Schulen durch überdurchschnittliche Umweltmotivation, Wissen und Aktivität von Schülern anderer Schulen unterscheiden lassen. Mehr Schüler dieser Schulen werden die Motivationsprofile MOT1 und MOT2 statt MOT3 und MOT4 aufzeigen, über ein höheres Wissen über die Schulökologie verfügen und der Umweltaktivitätsgruppe "aktive" gehören.
Andererseits wird eine ökologische Schulkultur erwartet, die wegen der niedrigen Ausprägung beider Dimensionen als "schwach" gekennzeichnet werden muß. Vermutlich werden Schüler an solchen Schulen von der Abwesenheit ökologischer Gestaltung und Praktiken nicht begünstigt. Ein größeren Teil dieser Schüler müßte die Motivationsprofile MOT3 und MOT4 aufzeigen, über ein unterdurchschnittliches Wissen verfügen und der Umweltaktivitätsgruppe "gering bis inaktiv" angehören.
Zwei weitere Mischformen werden erwartet. Schulen des Typus "standard" neigen dazu, ihren Einsatz für die Umwelt hauptsächlich durch gestalterische Bemühungen umzusetzen. Praktiken, Verhaltensweisen an der Schule werden generell keine besondere Bedeutung zugemessen. Und letztlich werden "andere" Schulen erwartet, die die zwar wenig "Sichtbares" zum Thema Umwelt und Ökologie umgesetzt haben aber in ihren Praktiken, z.B. in ihrer Förderung des Partizipationsprozesses der Schüler, an der Schule ein Zeichen gesetzt haben.
Im Frühjahr 1998, circa ein Jahr nach der Erhebung der Schülerdaten, wurden die schulische "Landschaftsbewertung" und das Interview an den 12 ausgewählten Schulen durchgeführt. Alle Schulen waren kooperativ.
Ich führte alle Beobachtungen und Interviews durch. Eine Beobachtung dauerte in der Regel 2,5 bis 3 Stunden. Daten wurden schriftlich und photographisch festgehalten. Ein Interview fand mit der Schulleitung, in der Regel mit dem Schulleiter oder mit der Schulleiterin statt. Es war konzipiert, nicht länger als eine Unterrichtsstunde zu dauern. Auf Wunsch der Schulleitung ist ein längeres Gespräch von circa 2 Stunden dann aber eher die Regel gewesen. Manchmal wurden auf Eigeninitiative der Schulleitungen auch die Hausmeister zum Interview eingeladen. Das Interview wurde sowohl schriftlich festgehalten als auch auf Tonband aufgenommen.
Ergebnisse bei einzelnen Indikatoren und das Auswertungsverfahren
In Abschnitt 5.4 sind Ergebnisse der Nacherhebung und das Auswertungsverfahren erläutert:
Deskriptiver Teil:
Strukturen:
Hier werden nur Ergebnisse über Punkt 4 dargestellt (Abschnitt 5.4.5).
Im Hinblick auf die erwünschte Zielrichtung, nämlich die Identifizierung von unterschiedlichen ökologischen Schulkulturen, ist es erforderlich, Schulen zu identifizieren, die sich in ihrer Ausprägung der untersuchten Merkmale unterscheiden. Dafür wurden Skalenwerte für die einzelnen Indikatoren oder Variablen und für die gesamten Dimensionen ("Gestaltung" und "Praktiken" im Natur- und Umweltschutz) berechnet.
Die Antwortkategorien für beide Beobachtungs- und Interview-Variablen waren so konzipiert, daß sie eine dreistufige Skala der Variablenausprägung darstellten. Für jeden Indikator wurde die Schule einer von drei Klassen (hohe, mittlere und niedrige Ausprägung) zugeordnet. So konnten die Merkmale auf ihre Wirkung auf Schüler untersucht werden. Entsprechend wurden alle Merkmale, die die ökologische Kultur kennzeichnen, zu einer 4-stufigen Gesamtausprägung zusammengefaßt.
Nach der Klassifizierung wurden die Schulen, die in den beiden Bereichen Umweltgestaltung und Umweltpraktiken gute Ausprägungen haben, als Schulen bezeichnet, die eine "starke" ökologische Schulkultur aufweisen. Dies sind drei Schulen aus der Stichprobe von 12. Drei Schulen wurden identifiziert, die keine besondere Ausprägung aufweisen. Sie werden als "schwach" bezeichnet. Dazwischen liegen zwei gleich große Mischformen. Für jede ökologische Schulkultur wurden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Schülereffekte analysiert. Die vier ökologischen Kulturen und ihre Wirkungen werden in Abb. 7 dargestellt und in Abb. 8 zusammengefaßt.
Abbildung 7: Werte der abhängigen Variablen der Schulen, die einer der vier ökologischen Kulturen zugeordnet wurden
Abbildung 8: Vier identifizierte ökologische Schulkulturen und ihre Wirkungen auf Schüler
Wirkungen von ökologischer Schulkultur auf Umweltaktivitäten an der Schule
Fazit: Es konnte bestätigt werden, daß eine "starke" ökologischen Kultur eine positive Wirkung auf das Engagement ihrer Schüler hat. Dagegen ist an Schulen, deren ökologische Kultur einseitig ausgeprägt ist, auch eine negative Auswirkung bei den Schülern zu beobachten. Überraschend ist der Befund, daß in unserem Sample einen "schwache" ökologische Kultur keinen eindeutig hemmenden Einfluß auf das Schülerengagement hat.
Wirkung von ökologischer Schulkultur auf Wissen über die Umwelt und Ökologie an der Schule bei Schülern
Fazit: Der Wissensgrad steigt mit zunehmender Ausprägung der ökologischen Kultur an der Schule. Der Effekt ist für Schüler aller Wissenskategorien der beiden "starken" und "schwachen" Schulen sowie für beide mittleren Wissenskategorien der übrigen Schulkulturen deutlich.
Wirkung von ökologischer Schulkultur auf die Motivation zu Umwelthandeln bei Schülern
Fazit: Der Einfluß ökologischer Schulkultur auf Schülermotivation nimmt einen komplizierten Verlauf. Es ist z.B. aus den empirischen Befunden nicht eindeutig ableitbar, inwieweit die mittleren Motivationsgruppen eine Auswirkung zwischen den "Extremen" darstellen. Auch in Betrachtung der einzelnen vier Kulturen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf die Schülermotivation ist kein eindeutiger Verlauf zu belegen. Es scheint eher, als ob die Schüler der einen Motivationsgruppe auf Einflüsse nicht "mehr" oder "weniger" reagieren sondern eher "anders" als Schüler der übrigen Gruppen. So fördern z.B. "starke" Schulen überraschenderweise MOT4 (die "niedrigen") wie MOT1 (die "hohen") Schüler. Schulen mit "ÖkoPraktiken" scheinen in bezug auf Schülermotivation genau das Gegenteil dessen zu bewirken, was zunächst erwartet worden war. Und an den "schwachen" Schulen ist der Anteil der MOT4 Schüler deutlich kleiner (7%) und der MOT2 Schüler größer (11%) als der Durchschnitt! Es läßt sich aus diesem Grund vermuten, daß die vier Motivationsgruppen kein Kontinuum der Motivationsentwicklung abbilden, daß Schüler sich aus dem Motivationsprofil MOT4 über MOT3 und MOT2 Profile auf das Profil MOT1 fortentwickeln. Es würde von daher ein falsches Bild vermitteln, sagen zu wollen, daß Umweltmotivation sich "verbessert" mit zunehmender Ausprägung der ökologischen Kultur, da Schüler unterschiedlicher Motivationsprofile buchstäblich anders wären. Eine "Besserung" in diesem Sinne wäre ausgeschlossen. Vielmehr scheint es eher so zu sein, daß unterschiedliche Personentypen hinsichtlich umweltrelevanten Handelns auf ökologische Schulkultur unterschiedlich reagieren.
Insgesamt, wenn die Ergebnisse über die Auswirkungen von ökologischen Schulkulturen auf Schüler mit den ursprünglichen Erwartungen verglichen werden, enstanden uns also einige Überraschungen:
Im folgenden werden für die einzelnen ökologischen Kulturen die erwarteten und aktuellen Ergebnisse noch einmal zusammengefaßt und aufgelistet.
Fazit: die "starke" ökologische Schulkultur stimmt in allen Fällen mit den Erwartungen überein außer in einem. Schüleraktivität, Wissen und Motivation sind am "besten" an diesen Schulen. Überraschend ist es, daß an diesen Schulen der Anteil der niedrigstmotivierten Schülern proportional auch sehr hoch ist.
Fazit: "ÖkoGestaltung"-Schulen sind für ihre positive Ausprägung im Bereich schulischer Gestaltung für Natur- und Umweltschutz gekennzeichnet. Ihre Ausprägung im Bereich der Praktiken ist eher schwach. Es wurde erwartet, daß diese Kultur, ähnlich wie die "starke" Kultur, eine eher positive Auswirkung auf Schüler haben würde, wenn auch nicht ganz so stark ausgeprägt, wie an den "starken" Schulen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der "starken" ökologischen Schulkultur, haben die Ergebnisse die Erwartungen jedoch nicht bestätigt. Schülerengagement bei schulischen Aktivitäten zum Natur- und Umweltschutz ist niedriger als erwartet. Der Anteil von Schülern, die "gering bis inaktiv" sind, ist hier am höchsten über die gesamte Stichprobe hinweg. Sogar der Anteil von Schülern, die von Entsorgungs- und Pflegeaktivitäten berichteten, ist unterrepräsentiert. Dies ist überraschend, weil man meinen könnte, daß Schulen, die einen Wert auf die Gestaltung der Schule (insbes. auf die des Geländes) und auf Natur- und Umweltschutz legen, ihre Schüler in gerade diese Aktivitäten einbeziehen würden. Andererseits haben die Ergebnisse über die Umweltmotivation von Schülern unsere Erwartungen übertroffen. An diesen Schulen ist die Zusammensetzung von Motivationsgruppen "besser" als erwartet. Hier ist der Anteil der hochmotivierten Schüler (MOT1) verhältnismäßig höher als der Durchschnitt und der Anteil der niedrigstmotivierten (MOT4) liegt niedriger. Schülerwissen über Umwelt und Ökologie der Schule ist durchschnittlich und - wie erwartet - das zweitbeste aller vier ökologischen Schulkulturen.
Fazit: Schulen der Kategorie "ÖkoPraktiken", sind durch ihre Ausprägung im Bereich Praktiken im Natur- und Umweltschutz sowie Schülerpartizipation gekennzeichnet. Die Ergebnisse ihrer Auswirkungen auf Schüler deuten darauf hin, daß Schülerengagement bei Natur- und Umweltschutzaktivitäten an diesen Schulen tendenziell unterdurchschnittlich ist. Aus der Sicht der Schüler werden Aktivitäten im Bereich der Entsorgung und Pflege übermäßig oft wahrgenommen. Andererseits berichten Schüler am seltensten, "gering bis inaktiv" an diesen Schulen zu sein. Wissen an diesen Schulen nimmt - wie erwartet -den dritten Platz ein und ist damit unterdurchschnittlich. Das Ergebnis über Umweltmotivation hinsichtlich der Erwartung war enttäuschend. Die Anteile der höhermotivierten Schülergruppen (MOT1 und MOT2) sinken unter den Durchschnitt und die der niedrigermotivierten (MOT3 und MOT4) nehmen zu. In bezug auf die Zusammensetzung der Motivationsgruppen stehen diese Schulen für eine positive Auswirkung auf Umweltmotivation an letzter Stelle.
Fazit: Die "schwache" ökologische Kultur war wegen ihrer niedrigen Ausprägungen für Gestaltung und Praktiken hinsichtlich Umwelt und Ökologie an der Schule so benannt worden. Im bezug auf die Ergebnisse zu ihrer Auswirkung auf Schüler allerdings ist diese Benennung offenbar falsch gewählt. Erwartungsgemäß haben Schüler an diesen Schulen zwar das im Vergleich geringste Wissen über die Umwelt und Ökologie dort. Aber ihr Engagement ist durchschnittlich, d.h. besser als an einigen Schulen, die eine "bessere" ökologische Schulkultur aufweisen können. Motivation an diesen Schulen ist auch etwas "besser" als durchschnittlich. Vergleichsweise haben diese Schulen überdurchschnittlich viele Schüler mit dem "zweithöchsten" Motivationsprofil (circa 10% mehr MOT2) und weniger mit dem "niedrigsten" (MOT4 circa 8%).
Hiermit beende ich die Zusammenfassung der Ergebnisse. Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz in der Pädagogik und für weitere Forschungen erörtert.
| Home | Inhalt |
Zu Kapitel 6 "Diskussion"
Es war anhand der damaligen Erhebungsinstrumente der Hauptstudie an über 54 deutschen Schulen unterschiedlicher ökologischer Charakteristik und struktureller Merkmale nicht möglich, die "ökologischen" und die "nicht ökologischen" Schulen zu unterscheiden. Die Nachuntersuchung ist diesem Problem nachgegangen und strebte an, schulische Merkmale zu identifizieren, die die Schülermotivation zu umweltrelevantem Handeln fördern. Diese Merkmale wurden bisher in der Theorie zwar als potentielle Einflußfaktoren diskutiert, mußten aber im Rahmen des angewendeten Auswertungsverfahrens als Variablen beschrieben und operationalisiert werden. So konnte eine Verknüpfung zwischen den schulischen Merkmalen und den Effekten bei Schülern gewährleistet werden.
Die Arbeitsthese lautete:
Schulen, die ihr Gelände ökologisch gestalten, aktuelle (kulturell bedingte) Praktiken in Natur- und Umweltschutz widerspiegeln, Schülerpartizipation bei relevanten Entscheidungsprozessen an der Schule fördern und eine positive Haltung zum Natur- und Umweltschutz vor Ort an der Schule zeigen, zeigen eine positiv ausgeprägte ökologische Kultur. Dadurch fördern diese Schulen Sensibilität sowie Fähigkeiten in Sachen Natur und Umwelt bei Schülern. Diese Schüler werden einen höheren Wissensgrad über Natur- und Umweltschutz an der Schule und ausgeprägteres Natur- und Umweltschutzengagement an der Schule zeigen, die sich in einer höheren umweltrelevanten Motivation niederschlagen.
Die Ergebnisse werden in dieser Reihenfolge diskutiert:
Zu Schülereffekten
In seiner sehr umfassenden Literaturrecherche stellte Bolscho (1986) fest, daß die schulische Umwelt einen Effekt auf Kinder und Jugendliche haben müßte. Aber er konnte bis zu dieser Zeit noch keinerlei empirischen Beleg dafür liefern. Er untersuchte Forschungsarbeiten in der Bereichen: Sozialisation, Umwelt, Umwelt-psychologie, Unterricht, Umweltkognitionen und Schulklima.
Zwölf Jahre später wurden die ökologische Gestaltung und Praktiken an Schulen (die "ökologische Schulkultur") auf Schülereffekte hinsichtlich schulökologisches Wissens, Motivation und Aktivitäten untersucht.
Das Wissen der Schüler
"Wissen" ist ein beliebter Indikator für Effekte der Bildungsforschung. Auch in dieser Studie wurde es berücksichtigt. Wissen ist hier allerdings durch "Wissen vor Ort" über Natur- und Umweltschutz an der Schule definiert. Das übliche Fakten- oder Konzeptwissen über ökologische Sachverhalte ist nicht enthalten.
Wissen zeigt den "idealen" Verlauf: mit steigender Ausprägung der ökologischen Kultur steigt auch der Wissensgrad der Schüler. Schüler an Schulen einer "starken" ökologischen Kultur zeigen das höchste Wissen über Natur- und Umweltschutz ihrer Schule. Schüler an Schulen einer "schwachen" ökologischen Kultur zeigen das Niedrigste.
Ein Ergebnis der vorläufigen Studie stellte heraus, daß das Wissen in bezug auf Motivation auch einen "idealen" Verlauf zeigt: mit steigender Ausprägung des Wissensgrades steigt auch die Motivation der Schüler.
Allerdings folgt nicht daraus, daß die Motivation mit der ökologischen Kultur ähnlich zusammenhängt. Eine steigende Ausprägung von ökologischer Kultur zusammen mit steigender Motivation wurde nicht beobachtet. D.h., obwohl es einen positiven Zusammenhang zwischen Wissen und Motivation und zwischen Wissen und ökologischer Kultur gibt, wäre es ein Trugschluß, daraus zu folgern, daß das Wissen für die meisten Schüler motivierend wirkt.
Im Kontext der ökologischen Schulkultur, wie im nächsten Abschnitt über Schülermotivation beschrieben, scheint es einen Einfluß von Wissen zu geben, der für manche Schüler fördernd und für andere hemmend wirkt.
Da es sich beim Wissen hier nicht einfach um faktische Informationen oder Sachverhalte handelt, handelt es sich auch nicht um ein Wissen, das durch eine Richtigstellung zu erlangen oder zu verbessern wäre. Hier wurde solches Wissen gewählt, das den Prozeß des Wissenserwerbs an den jeweiligen Schulen repräsentiert. Statt "Wissen" per se handelt es sich eher um eine (alternative) Denkweise, die nur im Rahmen der (ökologischen) Kultur der Schule zu verstehen ist und diese damit wiederspiegelt. Schüler an ökologischen Schulen sollen ökologisch denken. Das Wissen ökologisch denkender Schüler, insbesondere ihr Wissen über Natur- und Umweltschutz an ihrer Schule soll dadurch geprägt und erkennbar sein. Nur durch einen schulischen Kulturwandel würde dieses Wissen der Schüler zu "korrigieren" sein, vergleichbar in etwa zu einem Paradigmawechsel im Kuhníschen Sinn. Mit anderen Worten, eine Schule kann viel für die Umwelt tun, wirklich ökologisch ist sie erst dann, wenn sie es auch in den Köpfen der Schüler ist. In dieser Hinsicht könnte eine Weiterentwicklung des ökologischen Kulturwandels aller untersuchten Schulen noch stattfinden.
Die Motivation der Schüler
Diese Forschungsarbeit konnte vier Motivationsprofile bei Schülern identifizieren, umweltrelevant zu handeln. Auf den ersten Blick scheinen die vier Profile ein Kontinuum von niedriger bis hoher Motivation darzustellen. Die Ergebnisse zeigen jedoch eher, daß Motivation einem komplexeren Verlauf folgt. Obwohl die ökologische Kultur einer Schule nach den Ergebnissen dieser Studie einen Einfluß auf die Motivation ihrer Schüler hat, kann nicht unterstellt werden, daß sich z. B. Schüler der MOT4 schrittweise "hoch" motivieren lassen, oder daß etwas, was einen Motivationseffekt hervorruft, dies für alle Schüler in gleicher Weise oder Richtung tut. Schüler eines Motivationsprofils werden von den untersuchten Faktoren anders beeinflußt als Schüler anderer Profile.
In der Tendenz kann man sagen, daß eine positiv ausgeprägte ökologische Schulkultur einen positiven Effekt auf die Schülermotivation hat, umweltrelevant zu handeln. Es wurden allerdings zwei bemerkenswerte Effekte der ökologischen Kultur auf Schüler beobachtet:
Während, erstens, an Schulen mit einer "starken" ökologischen Kultur die Anzahl der höchstmotivierten Schüler (MOT1) steigt, steigt auch die Anzahl der niedrig-motivierten Schüler. Wie aber kann es durch eine starke ökologische Kultur zu einer erhöhten Anzahl von niedrigmotivierten Schülern kommen?
Ein Blick auf die Antwortprofile der beiden mittleren Motivationstypen (Schüler, die vermutlich am ehesten in die niedrigmotivierten Gruppe reinrutschen würden) zeigt, grob gesagt, daß diese beiden mittleren Gruppen den niedrigmotivierten Schülern in ihren Scores für Coping-Stil, Soziale Norm und Kompetenzerwartung sowieso ähneln. Ein Verfall der Motivation bei den mittelmotivierten Schülern würde dann stattfinden, wenn zusätzlich eines oder mehrere der übrigen Motivationsmerkmale (beispielsweise "situative Barrieren", "Verantwortungsattribution" oder "Instrumentalität") durch eine "starke" ökologische Kultur nicht gefördert werden kann. Umweltthemen sind komplex und rufen bei Menschen anderer Meinung und anderer Ansprüche unterschiedliche Erwartungen hervor. Es ist durchaus möglich, daß, was eine Schule im Interesse der ökologischer Kultur tut, von einigen Schülern als konflikthaft oder zumindest als problematisch empfunden wird. Ein solcher Konflikt könnte demotivierend wirken. Niedrige Motivation muß also nicht Folge einer intrinsischen Charaktereigenschaft des Schülers sein, sondern hat möglicherweise extrinsische und schulspezifische Ursachen.
Im Originaltext werden vier Thesen erläutert, die mögliche Erklärungen liefern, wie im Falle "starker" ökologischer Kultur die Ausprägung der genannten Motivationsindikatoren bei einigen Schülern verfallen könnten (Siehe Table 6-1).
Zweitens war postuliert worden, daß je stärker die Ausprägung der ökologischen Kultur, desto größer der beobachtbare (positive) Effekt bei den Schülern ausfallen würde. Dieses Postulat erwies sich als nicht haltbar. Nicht nur sind an Schulen höchster Ausprägung ökologischer Schulkultur die niedrigstmotivierten Schüler überdurchschnittlich repräsentiert, sondern auch die niedrigstmotivierten Schüler sind an Schulen niedrigster Ausprägung ökologischer Schulkultur ("schwach") deutlich unterrepräsentiert (Anteil MOT4 ist 16% im Vergleich mit einem Durchschnitt von ca. 23%). In Table 6-1 des Originaltextes finden sich drei Argumente dafür, daß die Motivation an Schulen der "schwächsten" ökologischen Schulkultur nicht notwendigerweise beeinträchtigt sein muß.
Diese Beobachtungen deuten darauf hin, daß das Nachahmen kultureller Ereignisse (z.B. Umweltverhalten), wie es von Bronfenbrenner und Vygotski unterstrichen wurde, im Rahmen der Schule nur für einen Teil der Schüler relevant ist. Im Hinblick auf die Umweltmotivation bei Schülern scheint es etwa so zu sein, daß viele Schüler diese ökologische Kultur nicht wahrnehmen können oder nicht hinnehmen wollen. Meiner Meinung nach müssen wir ein besseres Verständnis dafür gewinnen, wie sich die Motivation, umweltrelevant zu handeln, während des Kindes- und Jugendalters insgesamt einstellt und entwickelt.
Es geht darum, das Auftreten besonderer Empfänglichkeitsperioden, auch "sensible Perioden" genannt, zu identifizieren. Diese Perioden sind von vorübergehender Dauer und ermöglichen die Erwerbung bestimmter Fähigkeiten (Montessori, 1993). Welche Fähigkeiten hängen mit welchen Empfänglichkeitsperioden zusammen, die die Entwicklung von Motivation zu umweltrelevantem Handeln begünstigen? Ähnlich, wie es "sensible Perioden" für den Erwerb von Fähigkeiten gibt, ist es vorstellbar, daß sich auch sensible Perioden für Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen identifizieren lassen (z.B. das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, nach Autonomie oder nach Bezogenheit). Bezüglich der Förderung von Motivation sowie von relevanten (Schlüssel)erlebnissen (Handlungs- bzw. Partizipationsmöglichkeiten) wird dies vermutlich an Schulen stattfinden, an denen die Sensibilitäten der Schüler verstanden und Inhalte und Methoden ihrer Angebote entsprechend angepaßt werden können. Wäre es also z.B. eher wirkungsvoll die Kompetenzerwartung bei Schülern zu fördern, indem die Schule gezielt Angebote macht, die an solche sensiblen Perioden ankoppeln über beispielsweise Selbstverwirklichung sowie passenden Fähigkeiten?
Die Aktivitäten der Schüler
Die Ergebnisse deuten auf einen Einfluß von ökologischer Kultur auf Umweltaktivitäten der Schüler hin. Allerdings wurden durch diese Untersuchung mehr Fragen als Antworten angeregt und deshalb wenig Erklärungen des Zusammenhangs zwischen Schüleraktivitäten und Motivation angeboten. (Siehe auch den vorhergehenden Abschnitt über Motivation.)
Das Konzept, was "Aktivität" oder "Handeln" im Bereich Natur und Umwelt ist, und wie es in der Forschung repräsentiert werden sollen, bedarf weiterer wissenschaftlicher Klärung. Sind z.B. "gute" Gewohnheiten oder neue Aneignungen gemeint? Sind es die von der Gesellschaft akzeptierten Forderungen, die die jungen Leute mitreißen und von ihnen nachgeahmt werden sollten? Reden wir von der Akzeptanz und Fortsetzung von Fähigkeiten und gegenwärtiger "Kultur" oder von Präferenzen des Handelns und dem freiwilligen Gestalten eines alternativen Lebensstils? Sicherlich sollen wir Ereignisse, die sich in ihrer Zeitspanne unterscheiden, nicht (mehr) gleich behandeln. Aber können wir überhaupt unterschiedliche Aktivitäten oder Handlungen vergleichen und wenn ja, dann unter welchen Bedingungen? Auch müßten motorische und geistige Tätigkeiten deutlich unterschieden werden, aber wie und mit welcher Auswirkung? Anteilnahme ("going through the motions") ist nicht gleich "Partizipation" (durch und durch dabei sein, mitentscheiden, mitwirken). Wann und mit welchen pädagogischen Zielen setzt man Übungen ein? Und wann den "holistischen" Ansatz? Welche Rolle spielt eigentlich der demokratische Prozeß beim menschlichen Verhalten? Welche Aktivitäten und Handlungsabläufe sind es konkret, die die erstrebten Arten von Erfahrungen (Lucas, Moore, Fietkau, Dewey und vielen anderen) ausmachen?
Solange diese und ähnliche Fragen noch offen stehen, wird weder die Zielsetzung noch eine Beurteilung erstrebenswerter Angebote von Aktivitäten und Handlungsbedingungen an Schulen eindeutig definierbar sein.
Zur ökologischen Kultur an den Schulen
Hinsichtlich der Arbeitshypothese, daß ökologische Schulkultur zu identifizieren sei, daß die entscheidenden Merkmale ökologischer Kultur eine positive Auswirkung auf Schüleraktivität und -wissen haben und dies wiederum erhöhte Motivation auslöse, deuten die Ergebnisse darauf hin, daß:
Diese Untersuchung konzentrierte sich auf zwei Aspekte, anhand derer ökologische Schulkultur identifiziert und beurteilt werden sollte. Die zwei Aspekte "Umwelteinrichtungen" und allgemeine "Umweltpraktiken" an der Schule wurden in ein Wirkungsmodell der Umweltbildung eingearbeitet. Es konnten vier ökologische Kulturen an Schulen identifiziert werden, die nachvollziehbare Effekte auf ihre Schüler aufweisen.
Interessant war das Ergebnis, daß die untersuchten zwei Dimensionen oder Aspekte zwar gemeinsam zu deutlichen positiven Schülereffekten führen, der Effekt für Schulen aber, an denen nur einer dieser zwei Aspekte eine gute Ausprägung hat, nicht unbedingt "besser" ist als der Effekt an Schulen mit "keiner" ökologischen Kultur. "Ein bißchen was tun" oder "Hauptsache irgendwas tun" ist somit nicht eindeutig zum motivationalen Vorteil der Schüler in diesem Alter. Schulen mit keiner besonderen Ausprägung dieser beiden Aspekte hatten durchaus überdurchschnittlich positive Effekte bei ihren Schülern (können diese evtl. gar nichts falsch machen?).
Wie die mittleren Ausprägungen ökologischer Schulkulturen zu "negativen" Effekten bei Schülern führen konnten, ist im Text diskutiert (Siehe Abschnitt 6.2 Figure 6-1). Kurz gesagt geht es darum, daß Schulen durch ihre Art ökologischer Kultur eine Botschaft an die Schüler senden. Nur ein Teil dieser Botschaft besteht darin, was wie für die Umwelt getan werden sollte - und dies auf einem Niveau, das den Ansprüchen und Bedürfnissen einiger Schüler eventuell nicht entspricht. Hinzukommt, daß zugleich Informationen über das Verhältnis zwischen Schülern und Erwachsenen an der Schule sowie Erwartungen an Schüler mitvermittelt werden. Das so Vermittelte muß weder unbedingt klar noch beabsichtigt sein, kann aber für einige Schüler demotivierend wirken (Siehe Schulz von Thun, 1981).
Zum Abschluß dieses Abschnitts ist es eventuell noch erwähnenswert, daß nur eine einzige der 12 Schulen mit ihrem Plan für die Gestaltung und Praktiken im Bereich Umwelt zufrieden oder bereits "fertig" war. Sogar in dem einen Jahr zwischen Hauptstudie und Nachuntersuchung war etliches neu in die Planung gekommen bzw. (an 3 - 4 Schulen) realisiert worden. Insbesondere wird viel Aufmerksamkeit der Geländegestaltung und dem Bereich alternative Energiequellen gewidmet. Ein Schulleiter guckte mich mit großen Augen an, als ich ihn fragte, ob oder wann er diesen Prozeß als abgeschlossen betrachten würde: Fertig? Wir werden nie fertig! Was hätten die folgenden Schüler davon!! Es kommen immer neue Kinder dazu. Und womit sollen wir eigentlich fertig sein? Dieser Ansicht folgend, stelle ich mir eine Schule mit einer erweiterten ökologischen Kultur wie ein Spielfeld vor, mit Grundriß und einigen wenigen Spiel- oder Verhaltensregeln und dazu Unmengen von "Bausteinen", die abgebaut und wieder aufgebaut beziehungsweise umgebaut werden würden. Mit abnehmenden Alter müssen die Bausteine um so konkreter sein, mit zunehmendem Alter können sie um so abstrakter sein, um die Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse der Schüler mit dem Lernziel ("verantwortungsvoller Umgang mit Natur und Umwelt") besser in Einklang zu bringen. Sicherlich muß eine Schulkultur Strukturen anbieten, sonst gäbe es keine Kultur, aber wir dürfen umgekehrt nicht den Schülern alles vorwegnehmen. Die für sie maßgebliche Kultur müssen sie selbst mitbestimmen können, um Teil der Kultur zu sein und ihres Verhaltens sicher zu werden/ bleiben.
Zu Methoden und Forschung
Für die Nachuntersuchung wurden neue Erhebungsinstrumente entwickelt. Die Beobachtungsinstrumente dienten dazu, aus der schulischen "Landschaft" die ökologische Gestaltung der Schulkultur ablesen zu können. Interviews mit der Schulleitung boten weitere Auskünfte über allgemeine ökologische Praktiken der jeweiligen Schulen an. Es war nicht zu erwarten, daß die Ergebnisse sehr affektsstark sein würden. Dafür war die Stichprobe zu klein und außerschulische Einflüsse auf Schüler nicht ganz auszuschließen. Trotzdem möchte ich behaupten, daß die Instrumente zu aussagekräftigen Ergebnissen geführt haben.
Eine Validierung der Instrumente ist in diesem Rahmen nicht möglich gewesen. Mehrfache Varianzanalysen (ANOVA) wurden für die Schülervariablen durchgeführt. Für einen überwiegenden Teil davon sind die Ergebnisse signifikant gewesen. Auf der Schulebene sind die Effekte zwangsläufig schwächer. Varianzanalysen zwischen Schülereffekten und Ausprägung ökologischer Kultur sind immerhin mehrfach signifikant gewesen. Für die einzelnen Indikatoren war es nur sinnvoll, einen Extremschulgruppenvergleich durchzuführen. Der Vergleich deutet auf Zusammenhänge zwischen einzelnen Indikatoren und Schülereffekten hin.
Diese Untersuchung ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie das statistische Auswertungsverfahren Mixed-Rasch-Modell und Latent-Class-Analyse viele Daten und komplexe Variablenzusammenhänge vereinfacht darstellen kann. Ich habe Profile von Schülern und Profile ihrer Motivation entwickeln können, die für praktische Tätigkeiten im Bereich Bildung konkrete Anknüpfungspunkte bieten. Ich denke, einen Einblick geboten zu haben in die Komplexität von Schülermotivation, sich umweltgerecht zu verhalten und welche Rolle die ökologische Kultur einer Schule dabei spielen könnte. (Weitere Überlegungen über Methoden und weitere Forschungstätigkeiten in diesem Feld finden sich im Originaltext.)
Die zwei neu entwickelten Instrumente scheinen uns einen kleinen Schritt näher an die quantitative Analyse von bisher qualitativen Variablen gebracht zu haben.
Bedeutung für Bildung im allgemeinen
Es wurde behauptet und mit den Ergebnissen dieser Untersuchung unterstützt, daß die ökologische Kultur einer Schule in bezug auf schulische Umweltbildung einen zentralen Beitrag zur Effektivität schulischer Umweltbildung leistet. Es konnte gezeigt werden, daß ein Zusammenhang zwischen ökologischer Kultur und den vom Kultusministerium geforderten Aufgaben der Schulen besteht und zumindest dargestellt werden, daß eine Förderung des "Wohlbefindens" und des "verantwortlichen Handelns" bei Schülern nicht ausschließlich an Schulen durch Unterricht zu leisten ist. Der Einfluß der ökologischen Schulkultur und die damit verbundenen pädagogischen und didaktischen Möglichkeiten müssen weiter in Betracht gezogen werden, wenn nachhaltige Erfolge in diesem Bereich ernsthaft erzielt werden sollen, auch wenn mit dem Begriff einer ökologischen Kultur viel "Etikettenschwindel" getrieben werden kann.
Fünf allgemeine didaktische Leitideen sind für den Bildungsprozeß auf den "2. Schulischen Umweltgesprächen" (Hesse, 1996) vorgeschlagen worden. Die sind:
Die konkrete Umsetzung dieser Leitideen fällt allerdings schwer. Ihr gegenüber stehen die "Wenn und Aber" aus Beobachtungen und Erfahrungen:
Für die einzelnen Lehrkräfte ist die Aufgabe, alle diese Anforderungen unter einen Hut zu kriegen, nicht realisierbar. Deshalb wurden zwei Grundvoraussetzungen formuliert:
Pointiert formuliert: Schulen, die sich ihrer Rolle in der Entwicklung einer ökologischen Kultur bewußt sind, sind weitaus eher in der Lage, ihre Schüler durch einen authentischen Lernprozeß begleiten zu können und damit die heranwachsenden jungen Menschen als befähigte, motivierte Mitgestalter des Lebens zu fördern.
Mit dieser Studie konnten diese Überlegungen ein Stück weit "belegt" und unterstützt werden. Diese Arbeit hat gezeigt, daß sowohl die ökologische Gestaltung als auch ökologische Praktiken Instrumente einer ökologischen Kultur der Schule sind und daß diese ökologische Kultur dazu beiträgt, die in der Umweltbildung besonders relevanten Aspekte des Umweltengagements, -wissens auf Schülerseite zu entwickeln.
An jeder Schule besteht jetzt schon eine ökologische Schulkultur, die durch ihre Gestaltung und Praktiken sowie Taten und Haltungen einzelner Menschen - und zwar vor allem derer, die an der Schule involviert sind, geprägt ist. Allerdings werden gegenwärtig als Ziel der Umweltbildung besondere, spezifische, oftmals "verantwortungsvolle" Handlungen von Schülern angestrebt, die aber hinsichtlich des größten Teils der untersuchten Schüler als nicht hinreichend betrachtet werden müssen. Einige Handlungsweisen verlangen offenbar nach Vorbildern und Übungsmöglichkeiten, die deren Nachahmung forcieren. Andere Handlungsweisen, die das Kriterium "verantwortungsvoll" erfüllen sollen, sind nach meiner Meinung damit nicht bedient. Diese Erwartung sollte nach meinem Verständnis auch für die Mehrheit der Schüler gelten. Für die meisten Schulen bedeutet dies einen Kulturwandel. Ein solcher Kulturwandel sollte kontinuierlich, konzeptionell und zielgeleitet erfolgen und muß als langfristiger Prozeß angesehen werden, der jeweils auf den sozialen und physikalischen Voraussetzungen einer Schule aufbaut und ansetzt.
All zu oft höre ich, daß die Zeit knapp werde bis sich die Menschen für das "richtige" Verhalten entschieden haben. Wir müßten jetzt handeln und zwar konsequent. Dies hat häufig zu uniformen Zielorientierungen geführt, welche - mit besten Absichten - gleich handelnde oder gleich denkende Menschen faktisch anstreben. Die schnelle Behebung durch Patentlösung bleibt aber trügerisch, wie wir in Deutschland z.B. beim Thema Müll feststellen müssen. Hier war als zentrales Problem die Mülltrennung definiert worden. Dazu wurde die gesamte Bevölkerung einigermäßen erfolgreich gezwungen, Müll im Haushalt konsequent getrennt zu sammeln. Bei einer solchen Definition und Abhandlung des Problems bleibt das Verhalten als Absonderung und nicht Bestandteil einer Entwicklung - einer menschlichen (Identitäts)entwicklung. Mülltrennung hat deshalb weder dazu beigetragen, daß der Konsum verpackungsärmer geworden ist, noch zu deutlichen Verbesserungen der Verpackungsart geführt. Sogar der Konsum von Getränken in Einwegverpackungen ist gestiegen und ein bundesweites Mehrwegflaschenrecyclingsystem (für Brotaufstriche, Honig, Soßen und der gleichen) gilt neuerdings als unrentabel und wird ab Februar 1999 abgeschafft. Als Beispiel aus der Nachuntersuchung: Elf von zwölf Schulleitern gaben an, daß Papier an der Schule getrennt gesammelt wird. Allerdings wurden nur an fünf dieser Schulen Sammelbehälter für Papier außerhalb des Klassenzimmers bereitgestellt, Restmülltonnen aber an allen - und folgerichtig machte Papier hier stets einen wesentlichen Bestandteil des Inhaltes aus. Das, was im einzelnen Klassenzimmer angestrebt wurde, wurde häufig mit dem Überschreiten der Türschwelle bedeutungslos und zunichte gemacht. Lösungswege, die nicht an die Identitätsentwicklung angebunden sind, sind nicht zukunftsfähig und damit nich t vertretbar.
| Home | Inhalt |